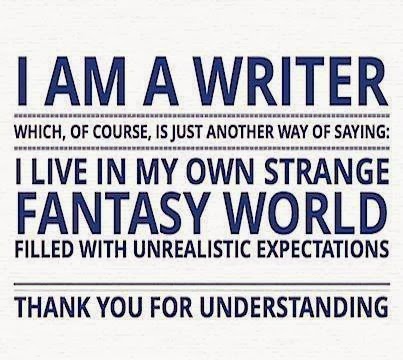31. Januar 2014
27. Januar 2014
Zeitlos
Zeitlos genial.
Wer es noch nicht gelesen hat: Hier meine Rezension zur KRAFTWERK Biographie von David Buckley.
26. Januar 2014
Danach
Ich würde sie sehen, die ersten Höhlenmaler, die Keilschriftmacher und die Entdecker des Papyrus. Ich würde dabei sein wollen, wenn Sokrates Platon unterrichtet, dieser sein Wissen an Aristoteles weitergibt und danach würde ich mit Alexander dem Großen in die Schlacht ziehen wollen. Wie ein Spanner wäre ich in der ersten Liebesnacht von Cäsar und Kleopatra dabei. Ich würde Judas bei seinem Bruderkuss in die Augen schauen wollen, hinter ihm stehen, ihm zuzwinkern. Ich würde überhaupt große Sprünge machen wollen. Vom Blick hinter den Bretterzaun in Dallas, in die Werkstatt von Gutenberg, vor das Portal einer Kirche in Wittenberg, zu einem Arbeiter in Tschernobyl, wenn er den falschen Knopf drückt. Zu einem Monument in einer Stadt und dort eine Rede hören, eine Rede über einen Traum und dort erleben, wie aus dem Wirrwarr an Gedanken eine Vision wird. Zu einem Dichter in dieser Nation oder jener, welcher in wenigen, sich reimenden Sätzen all die Essenz der wirklichen wichtigen Dinge verpackt und spürbar macht. Und zu einem Denker in Königsberg, der genau dieser Gedanken wieder rational entwirrt und sie doch so schwer für uns alle beschrieben hat. Zu einem Platz in Wien, wo ein verhinderter Künstler seine Postkarten verkauft, hin zu einer letzten Stufe einer Treppe an einem Raumschiff am Ende der sechziger Jahre. Ich würde hören, welche Sätze die Menschen dann sprechen, die bekannten und die weniger bekannten Sätze, würde endlich den Kontext verstehen, in den diese Welt gehört.
Aber ich würde niemals einer dieser Menschen selbst sein wollen. Denn mein eigentlicher Wunsch wäre ja nicht die andere Perspektive einzunehmen. Für andere Perspektiven gibt es auf dieser Welt doch Bücher, Filme, Musik ja die Fähigkeit zur Fantasie.
Nein, ich würde einen roten Faden mitnehmen, durch alle Zeiten, durch alle Räume, diesen an all den Ereignissen festmachen und mich schliesslich einspinnen in einen Kokon aus Zeit und Leben, aus Erkenntnissen und Geschichten. So würde sich die Unendlichkeit um mich herum schliessen - als sich selbst endlich als etwas Endliches begreifbar machen.
22. Januar 2014
Als der Torsten der Moni die Mütze geklaut hat (2)
Jetzt habe ich ein kleines Problem. Als ich gestern so für mich den Winter 1978 habe Revue passieren lassen - das mache ich nicht oft, aber wenn dann gründlich - da war ich mir plötzlich nicht mehr sicher, ob der Gestörte wirklich Torsten hiess. Es kann auch sein, dass er Stefan hiess oder es war sein großer Bruder Michael - ich bin mir da nicht sicher. Jetzt taucht der Name aber auch schon in der Überschrift auf. Egal. Das Böse hat eh keinen Namen. Bleiben wir also bei Torsten.
Ich war wütend. Von Minute zu Minute steigerte sich diese Wut bis ich mir nicht mehr erklären konnte, warum ich nicht einfach sofort eingegriffen und meine Moni beschützt hatte. Ich fasste den Entschluss, dass Torsten zu leiden hatte. Was niemand für möglich halten wird: in mir steckt ein Sadist.
 |
| "Der Sadist" Winter 1978 auf besagtem Garagenvorplatz |
Ich gab Torsten das Gefühl, mein liebster Spielkamerad zu sein. Fussball spielten wir nicht mehr auf der Wiese. Sondern auf dem Asphalt. Gegen die Nachbarn verbündeten wir uns und die Teppichklopfstange war das Tor. Ich spielte so dämlich vor dem Tor, nahe an einer Kante, die die Wiese und den Asphalt voneinander trennte, dass Torsten immer nahe an dieser Kante entlang lief. Mein Sadismus ging so weit, dass ich Torsten nicht einfach auf dem Asphalt ein Beinchen stellen wollte, nein es sollte möglichst in der Nähe dieser Kante sein. Ich stellte mir vor, wie er in vollem Lauf, die Beine von mir regelrecht weggetreten, voll auf die Schnauze fliegt, beide Knie blutig und damit es sich lohnt mit der Nase auf diese Kante. Opfer. Es sollte ein Opfer sein. Mein Timing war nicht perfekt, aber dennoch erstaunlich effektiv.
Drei Tage nach unserem Fussballspiel - es war ein sadistischer Erfolg erster Güte, leider war seine Nase heil geblieben, dafür war das eine Knie blutig und eine tiefe Wunde wegen der Kante im Oberschenkel - besuchte uns Torstens Mutter. "Nächste Woche kann er wieder in den Kindergarten. Er ist mit fünf Stichen genäht worden. Da wird wohl eine Narbe zurückbleiben."
Ich ging in mein Zimmer und freute mich still. Immer noch das schmerzerfüllte Schreien von Torsten drei Tage zuvor in den Ohren. Blutend und niedergetreten war er von dannen gezogen. Hach, war das toll.
Kommen wir jetzt aber zu dem sadistischen Teil. Seine Mutter sagte meiner Mutter, ich solle demnächst besser aufpassen. Wenn Torsten unbedingt Fussballspielen will, dann demnächst besser auf der Wiese. Ich sei ja der Vernünftigere von beiden. Zwei Vierjährige, die in Sichtweite der Mutter auf dem Hof Fussball spielten. Und ich war damals schon der Vernünftigere. Aber sicher. Torstens Mama hält heute noch große Stücke auf mich. Wie naiv die Menschen doch sind.
Wirklich sadistisch war aber, dass Torsten gar nicht kapiert hatte, dass ich ihm die Beine weggetreten hatte. Er hatte wohl gedacht, er sei irgendwie "hingefallen."
Ich liess ihn in dem Glauben. Bis heute. Er blieb mein Spielkamerad. Und wenn ich heute noch mit ihm Fussballspielen würde - der Asphalt wäre meine erste Wahl. Die Versuchung wäre nach wie vor groß. Ich musste mich damals immer wieder zurückhalten, meine Rache zu wiederholen. Aber das tat ich nie. Dafür gab es einen Grund.
Eine Woche nach meiner Rache fuhr ich mit einem Roller über den asphaltierten Garagevorplatz, fiel auf die Schnauze, mit der Nase auf den Lenker und habe seit dem eine kleine Narbe an der Nasenspitze. Ich habe geblutet wie Sau - mein Sturz geschah ohne Fremdeinwirkung. Torsten, der meinen Roller eventuell hätte manipuliert haben können, war weit und breit nicht zu sehen. Ich musste ein großes Pflaster auf der Nase tragen und meine Kindergartengruppe lachte sich halb tot.
Und raten sie mal, wer am lautesten gelacht hat? Torsten?
Nein. Moni.
Mir kann keiner mehr was. Ich habe am eigenen Leib die Gerechtigkeit erfahren.
21. Januar 2014
Als der Torsten der Moni die Mütze geklaut hat
Bevor ich zu Plan B schreite, muss ich mich mal etwas ins rechte Licht rücken. Es gibt da dunkle Seiten an mir, die muss ich mal unverklausuliert literarisch verwursten. Die Zeit ist wahrlich reif dafür.
Es ist etwas aus meiner Kindheit. Nein, nicht sowas. Also jetzt nichts für Hobby-Psychologinnen. Passt aber zu PLAN A. Ich war als Kind und junger Heranwachsender manchmal echt ein Arsch. Die Liste der Mädels, die ich pubertär und unbeholfen, grob und dumm, geärgert habe, ist echt lang. Ich war einer von der Sorte: was sich liebt das neckt sich. Ist das aber einseitig, dann gewinnt das Necken Oberhand. Und bleibt letztlich übrig. Aber dumme, kleine Jungen erkennen keinen Teufelskreis.
Naja - das war ja dann irgendwann anders. Ich bin ja jetzt kein dummer, pubertierender Doofmann mehr. (Auch wenn das immer noch einige ganz wenige Frauen behaupten). Da es aussichtslos wäre, ich aber der Dorfpoet mit dem verinnerlichten Sisyphos bin, versuche ich gar nicht erst, diese Liste abzuarbeiten.
Aber ein Statement muss ich abgeben. So pauschal. Es könnte als Erklärung dienen. Eigentlich wollte ich damit angeben, dass ich Simone de Beauvoir gelesen habe und weiß, welchen Schaden ich angerichtet habe. Aber damit habe ich bereits des Öfteren hier geprotzt. Nee, das ist kontraproduktiv.
Nicht, dass ich glaube, eine der Damen würde das hier lesen. Aber die Nachwelt muss wissen, was im Winter 1978 im Kindergarten in Troisdorf-Oberlar passiert ist, was ich bis heute für mich behalten habe und was meinem "Necken" einige Jahre später eine recht derbe Motivation mitgegeben hat.
Im Winter 1978, an irgend einem Tag, es hatte geschneit, da war unsere Kindergartengruppe draußen zum Schneemann bauen. Da hat Torsten der Moni die Mütze geklaut. Meiner Moni. Torsten wohnte im Nachbarhaus und heute würde man bei ihm ADHS diagnostizieren. Er konnte nicht ruhig sitzen, er war immer aktiv und zur Not ärgerte er seine Mitwelt.
Moni war meine Freundin. Eine Beziehung die tatsächlich nicht an mir, sondern an der unterschiedlichen Auswahl der dem Kindergarten nachfolgenden Grundschule durch die Eltern scheiterte.
Im Winter 1978 war es kalt. Moni frierte. Weil Torsten ihr grobmotorisch die Mütze geklaut hatte. Und Torsten rannte wie ein Depp über den kleinen Spielplatz des Kindergartens, seine Beute triumphierend schwenkend. Diese Tragödie wurde von keiner Kindergärtnerin beobachtet und verhindert.
Das eigentliche Drama aber spielte sich in mir ab. Ich glaubte später, ich hätte einen flehenden Blick der weinenden Moni gesehen. Ein stumme Aufforderung ihr zu helfen, ihr ihre Mütze wiederzuholen. Und was hab´ ich gemacht?
Nichts.
Gar nichts.
Ich war ein erbärmlicher Feigling. Das Gezeter und das Ungestüme von Torsten haben mich wohl gehemmt. Es war keine Angst, aber es war wohl das ultimative Neuland zum ersten Mal geforderter, unbändiger Männlichkeit - ein Terrain, auf dem ich mich erst sehr viel später, blind und zielsicher ... OK, lassen wir das ;-)
Es hätte also einer gewissen Männlichkeit bedarft, dem Treiben von Torsten Einhalt zu gebieten. Aber ich habe es nicht getan.
So weit, so gut.
Das Unglaubliche, was danach geschah, etwas, dass ich noch nie zuvor erzählt habe, absolut Niemandem, das ...
... erzähle ich im nächsten Posting ;-)
19. Januar 2014
David Buckley: KRAFTWERK - Die unautorisierte Biographie
Das Wort "unautorisiert" überrascht nun wirklich nicht. Wann werden die Mitglieder von KRAFTWERK schon jemals etwas autorisieren? Als das ehemalige KRAFTWERK-Mitglied Wolfgang Flür seine Biographie "Ich war ein Roboter" im Jahre 2002 veröffentlichte, war ein langer Rechtsstreit mit seinen ehemaligen Bandkollegen die Folge. 2004 durfte das Buch dennoch erscheinen und ist der bis heute einzige Einblick in das Innenleben von KRAFTWERK. Und was gibt es da noch? Pascal Bussy´s Buch über KRAFTWERK galt bisher als das Referenzwerk. Aber jetzt verspricht eine Neuerscheinung des Autors David Buckley mit dem Titel "KRAFTWERK - Die unautorisierte Biographie" diesen Mangel zu beheben. Hat das Buch das Zeug zum Referenzwerk über KRAFTWERK?
Das Vorwort zu diesem Buch schrieb kein geringerer als Karl Bartos, neben Flür das zweite ehemalige Mitglied von KRAFTWERK, welches nicht so gut auf die ehemaligen Kollegen zu sprechen ist. Flür und Bartos waren im Streit mit den Gründern Ralf Hütter und Florian Schneider aus der Band ausgeschieden ... Jedenfalls spricht das Vorwort von Bartos für dieses Buch. Erst war er abgeneigt, Fakten und Story zu bestätigen. Dann, als er mit dem fertigen Manuskript konfrontiert wurde, lobte Bartos Buckleys Buch. Das will etwas heissen.
Buckley unterteilt sein Buch in acht große Teile. Die Teile entsprechen mehr oder weniger chronologisch dem KRAFTWERK-Katalog der acht großen Studioalben, die vor knapp drei Jahren remastered erschienen sind. Abgerundet wird das Buch mit einer Discographie und interessanten Fakten über den Erfolg allseits bekannter KRAFTWERK-Songs. Buckley spannt dabei einen gekonnten sozio-kulturellen Bogen - KRAFTWERK im Kontext ihrer Zeit. Das Ergebnis ist banal und doch verblüffend zugleich. Eben wie ein KRAFTWERK Konzert.
 Ich habe KRAFTWERK selbst einmal live in Köln gesehen (das ist auch schon wieder zehn Jahre her). Da standen vier ältere Herren 2 1/2 Stunden hinter ihren Notebooks und machten Musik. Die Symbiose mit den Videos und die durchaus vorhandene Improvisation, machen so ein Konzert trotz seiner Schlichtheit und seiner Statik zu einem unglaublich dynamischen Erlebnis. Den KRAFTWERK Mythos gibt es wirklich. Das beginnt für mich 1977 als Vierjähriger der zu "Die Roboter" tanzt und wird 2014 mit einer Rezension zu einer KRAFTWERK Biographie längst noch nicht vorbei sein. Erst mussten ganze LKWs das Equipment für die Konzerte heranschaffen, dann waren es nur noch Notebooks ("Die Hardware ist jetzt so weit, wie die Software in unseren Köpfen") und seit knapp zwei Jahren gibt es die Konzerte nur noch in 3D.
Ich habe KRAFTWERK selbst einmal live in Köln gesehen (das ist auch schon wieder zehn Jahre her). Da standen vier ältere Herren 2 1/2 Stunden hinter ihren Notebooks und machten Musik. Die Symbiose mit den Videos und die durchaus vorhandene Improvisation, machen so ein Konzert trotz seiner Schlichtheit und seiner Statik zu einem unglaublich dynamischen Erlebnis. Den KRAFTWERK Mythos gibt es wirklich. Das beginnt für mich 1977 als Vierjähriger der zu "Die Roboter" tanzt und wird 2014 mit einer Rezension zu einer KRAFTWERK Biographie längst noch nicht vorbei sein. Erst mussten ganze LKWs das Equipment für die Konzerte heranschaffen, dann waren es nur noch Notebooks ("Die Hardware ist jetzt so weit, wie die Software in unseren Köpfen") und seit knapp zwei Jahren gibt es die Konzerte nur noch in 3D.
KRAFTWERK, die Musikarbeiter, waren und sind ihrer Zeit voraus.
Buckley gelingt es anhand seiner chronologischen Vorgehensweise, diese Eckpfeiler der Biographie herauszuarbeiten. Zwischen dem letzten Studioalbum 1986 und der äußerst produktiven Phase mit den meisten Konzerten der Bandgeschichte, gab es beispielsweise den legendären Auftritt beim Tribal Gathering 1997 in Luton. Es war der Startschuss zu einer zweiten Phase der Bandgeschichte, die aus dem Mythos KRAFTWERK eine Legende machten. Ein ganz neuer KRAFTWERK Song wurde gespielt und das Line-Up auf der Bühne war zukunftsweisend. Buckley zitiert hier Konzertbesucher und anerkannte Musik-Journalisten. Ein neues Album stehe kurz vor der Veröffentlichung hiess es damals. Aber es dauerte dann noch fast sieben Jahre, bis "TOUR DE FRANCE SOUNDTRACKS" erschien. Buckley nährt die vielen Gerüchte um die Band. Bei EMI in London sei die Band Ende der 90er Jahre gewesen und man habe dort ein Album vorgestellt. Das aber wurde nie veröffentlicht.
Folgt man den Ausführungen Buckleys dann war diese Entwicklung zum Mythos nicht vorhersehbar. Buckley bettet die KRAFTWERK - Chronologie in die Musikgeschichte der Zeit ein. Es ist wirklich überraschend, dass KRAFTWERK trotz allem Synthiepop der 80er Jahre und unzähligen Bands bis heute wegweisend sind. Vielleicht weil die vielen Bands der 80er KRAFTWERK nur zu gerne kopieren. Wie oft zogen KRAFTWERK vor Gericht, weil ihre Ideen geklaut (Sabrina Setlur) wurden? Und große Bands verneigen sich vor KRAFTWERK, wie etwa Coldplay mit ihrem Song "TALK", dessen Melodie das Thema von "Computerliebe" ist. Oder U2, die auf ihren offiziellen Tonträgern ausser den Beatles nur KRAFTWERK gecovert haben.
Das Buch ist ein unterhaltsamer Querschnitt eines Mythos ohne Inneneinsicht. Die Referenzen auf das Buch "Ich war ein Roboter" des ehemaligen KRAFTWERK Mitglieds Wolfgang Flür sind offensichtlich. Ansonsten ist das Buch eine lückenlose Vorstellung von Fakten im Mantel des musikalischen Zeitgeistes. Die fehlende Inneneinsicht kann man jedoch dem Autor nicht vorwerfen. Die beiden Gründungsmitglieder, die den Mythos sicher nicht entzaubern wollen, geben diesen Einblick nicht. Sie, die einzigen Konstanten über mehr als vier Jahrzehnte, verweigern sich jedem ernsthaften Journalisten.
Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass dieser Mythos sein Wurzeln in dieser Unbestimmtheit hat. Wollten wir - eingefleischte KRAFTWERK Fans oder nicht - denn eine Biographie über die vielleicht sehr gewöhnlichen Bandmitglieder lesen? Sicher nicht. Die Musikarbeiter schaffen Fakten. Und Fakten auf über 350 Seiten unterhaltsam zusammenzutragen - das ist eine beachtliche Leistung.
Taugt dieses Buch als Referenzwerk zu KRAFTWERK? - Ganz sicher. Erfahren wir hier viel Neues, Enthüllendes? Nein, ganz und gar nicht. Aber das ist eh kein Merkmal für ein gutes Buch. Und für ein Buch über KRAFTWERK schon mal gar nicht.
Über den Autor: David Buckley, geboren 1965, lebt und arbeitet seit 1992 in München. Er war mehrere Jahre Lehrbeauftragter für Popkultur an der Ludwig-Maximilian-Universität. Zahlreiche Buchveröffentlichungen, u.a. Biographien von David Bowie, R.E.M, The Stranglers.
16. Januar 2014
Where Have All The Cowboys Gone?
Ausführungen - beziehen sich auf mein vorheriges Posting, siehe unten. Dieses hier ist wohl das plakativste Posting ever. Wenn es sein muss buchstabiere ich mich durch alle Versuche, der jungen Dame argumentativ das Rauchen abzugewöhnen.
Also - meine Arbeit an einer Strategie macht enorme Fortschritte. Ich werde über ein kurzes Referat bezüglich des Feminismus im allgemeinen und im Besonderen der zentralen Aussage von Simone De Beauvoir, Emanzipation sei dann erfolgreich, wenn die Frau sei, wie es der Mann bereits ist, zu der hit-trächtigen Aussage "Where Have All The Cowboys Gone?" der Country Sängerin Paula Cole die Brücke und den dort in sich verschlungen verborgenen Paradoxien schlagen ...
(Für alle, die wieder meinen, ich schreibe hier unverständliches Zeugs - das ist jetzt ausnahmsweise mal so beabsichtigt gewesen.)
Aber - hier die Kurzfassung: Sie raucht, weil irgendjemand muss ja den Platz des Marlboro Mannes einnehmen. Als Frau ist das ein Statement von Emanzipation und eine Anklage, an die echten Kerle, die es wohl nicht mehr gibt.
Alternativ - Helmut Schmidt. Sind zwar nur Menthol Zigaretten. Als Cowboy in einem übertragenen Sinne könnte er durchgehen. Aber er ist 95. Und er lebt trotz jahrelanger Kettenraucherei. Er mag in vielerlei Hinsicht als Paradebeispiel dienen. Allerdings nicht für die Gefahren des Rauchens.
Ansonsten - Wenn ich jetzt wenigstens die Aussage "Ausnahmen bestätigen die Regel" mit Schmidt irgendwie mit Leben füllen könnte. Woher kommt eigentlich diese dämliche Aussage? Sie ist unlogisch und mit naturwissenschaftlichen Prinzipien unhaltbar. Stellt man nämlich eine wissenschaftliche Hypothese auf und findet bei empirischer Betrachtung auch nur ein einziges Gegenbeispiel, dann ist die ganze Hypothese für den
Arsch.
Helmut Schmidt ist dieses Gegenbeispiel. Da jauchzt jeder Raucher. Dafür steht das A in Plan A. Für den Arsch. Plan A impliziert Plan B. - denn, mit diesen
Argumenten
, die ich bisher ausgearbeitet habe, kann ich ihr unmöglich gegenübertreten. Plan A ist immer für den Arsch. Das ist der Zweck von Plan A. Also - Plan B. ist in
Arbeit.
13. Januar 2014
Klugscheisserei als Ultima Ratio
Als ich Mitte zwanzig war, da kam ein älterer Mann auf mich zu: "Junger Mann, wissen sie, dass in einer Zigarette 28 krebserregende Stoffe enthalten sind?" - Ich antwortete dem älteren Mann, der sich in diesem Moment als Klugscheisser darbot: "Also wenn es 29 wären, dann würde ich ja aufhören ..."
Ich fand das lustig. Damals.
Dann ist etwas in mir passiert. Das zu beschreiben wäre unwesentlich. Jedenfalls fand ich meine Reaktion damals lustig.
Worüber ich gar nicht lachen kann (es ist in gewisser Weise echt frustrierend) ist aber, dass ich jetzt dieser ältere Mann bin. Seit langem Nichtraucher. Und wenn ich jetzt zu ihr hingehen würde, sie würde genauso reagieren, wie ich damals. "Was will der alte Klugscheisser?", könnte sie denken. Nein, das wird sie denken. Ganz sicher. Ich könnte es ihr nicht verübeln. Sie wird ähnlich reagieren wie ich. Damals.
Und was wäre die Alternative? Wie könnte sie sonst reagieren?
"Äh. Ja, sie haben Recht. Vollkommen Recht! Ich mache jetzt die Kippe aus. Und ich zünde nie wieder eine Kippe an."
Genau
das
wird
passieren
:-(
Ich bin also ein alter Sack, der seine formidable Lebensweisheit einer hübschen, richtig hübschen jungen Dame kundzutun gedenkt, ohne sie ihr aufzubürden, ohne klugscheisserisch rüberzukommen, ohne mit zuviel, ohne zuwenig Ernsthaftigkeit etwas darzulegen, was ich nun ganz spontan als "Wesentlichkeit" benennen würde. ("Wesentlichkeit" - da war doch was?).
Es kommt also darauf an, wie ich es sage. Der Ton macht nicht die Musik. Der Ton ist die Musik. Das nennt man "Wesentlichkeit". Jetzt mal Butter bei die Fische. Also, Dorfpoet, streng Dich an ...
... ich denke mir was aus ...
... kommt schon noch ...
... in den nächsten Tagen ...
Die Klugscheisserei des Dorfpoeten welche keine ist. Keine sein soll.
Da habe ich mir was vorgenommen.
Seid gespannt. Es lohnt sich, wiederzukommen ... .
Spannende Lektüre & Verbesserungen
Ausserdem suche ich momentan nach einer Lösung, wie ich auf meiner Seite eine "Sitemap" integrieren kann. Das ist eine Art Inhaltsverzeichnis, das alle bisherigen Inhalte auflistet. Bei Google ist das in einer Sidebar gelöst, aber die habe ich aus meiner Seite entfernt, damit alles möglichst simpel aussieht. Es gibt eine Sitemap als XML Datei - nur wie wandel ich das in HTML um? - Ich glaube, da muss ich etwas basteln. Jedenfalls ist bei über 150 Einträgen ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis dringend notwendig.
12. Januar 2014
Wesentlichkeiten
Ich muss einem Rechtschreibprogramm immer dieses Wort beibringen. Wesentlichkeiten. Es ist rot unterstrichen, egal in welchem Schreibprogramm. Es existiert nicht. Das Wort "Wesentlichkeit" ist zwar im Duden, aber irgendwie scheint alles immer wieder auf das Adjektiv "wesentlich" zurückzufallen.
Die Wesentlichkeit ist ein Makro. Sie umfasst eine ganze Reihe von Eigenschaften. Jede dieser Eigenschaft selbst birgt in sich die Charakteristik des Wesens der Person oder Institution, die mit der Wesentlichkeit beschrieben werden soll. Und gleichzeitig ist jede konträre Eigenschaft die Umkehrung der Wesentlichkeit - also unwesentlich oder ihre Negation.
Nehmen wir als Beispiel Tebartz van Elst. Der ist Bischof von Limburg und war vor einigen Wochen in den Schlagzeilen, u.a. weil er jedes Maß beim Neubau seines Bischofssitz verloren hatte.
Zum Wesen eines Bischofs gehört das Vorleben christlicher Tugenden. Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Disziplin ... . All diese Tugenden ergeben zusammen die Wesentlichkeit. Die Wesentlichkeit ist also eine Mischung aus "Wesen" und "Sichtbarkeit" - wobei "sichtbar" nicht unbedingt physisch "sichtbar" ist, sondern auch eine Sichtbarkeit als Ergebnis eines Handelns meint.
Mindestens die Tugend der Bescheidenheit fällt in diesem Fall komplett aus. Die Wesentlichkeit eines Bischofs ist nicht die Wesentlichkeit eines Tebartz van Elst.
Warum also ist so ein wichtiges Wort nicht viel stärker im alltäglichen Gebrauch verankert? Nun, zumindest in meinen Texten hat es diese Verankerung.
Vermutlich hängt es damit zusammen, dass unter der Gruppierung von Eigenschaften und dem Rückschluss auf das Wesen eines Menschen, jeder etwas anderes versteht. Das Wesentliche ist losgelöst von einem Individuum. Die Wesentlichkeit ist die Charakterisierung eines Individuums in einem speziellen Kontext. Sie hängt nicht von diesem Individuum ab, sondern von der Perspektive desjenigen, der die Charakterisierung vornimmt. Wesentlichkeit ist also so etwas wie die Abstraktion des Individuellen - das birgt Gefahren.
Die Definition von Wesentlichkeiten funktioniert wirklich nur, wenn über den Kontext ein Konsens herrscht. Das geschieht immer und ausnahmslos über Fakten. Die Maßlosigkeit eines Tebartz van Elst ist Fakt. Dieser Fakt offenbart das Wesen dieses Menschen. Die Definition der Wesentlichkeit ist somit unstrittig.
So ist der Gebrauch von "Wesentlichkeit" mit großer Vorsicht zu geniessen. Denn was sagt uns, dass die Fakten des Kontext korrekt sind? In einer Zeit, in der Virtualität und Realität ineinander verschmelzen, sind Fakten besonders kritisch zu hinterfragen. Denn es wäre heute theoretisch denkbar, dass es den Syrischen Bürgerkrieg gar nicht gibt. Sämtliche Nachrichtenbeiträge sind vielleicht an einem Computer erzeugt worden. Das ist jetzt selbstverständlich keine Behauptung von mir - ich sage lediglich, dass dies technisch möglich ist.
"Die Wesentlichkeit" funktioniert nur rekursiv. Ich kann sie als Wort nur gebrauchen, wenn ich mir der Fakten, also der Realität sicher sein kann. Wesentlichkeit ist keine Annahme. Sie ist eine Tatsache. Sie hat somit das Merkmal, welches auch der Realität anhaftet. Auch diese kann nur rekursiv definiert werden, in dem man sie von der Virtualität abgrenzt. Bevor es die Virtualität gab, war diese Abgrenzung gar nicht notwendig, so wenig wie die Abgrenzung und "Wesen" und "Wesentlichkeit". Was also ist die Wesentlichkeit unserer Welt? Die Realität.
Was nun abschliessend im Raum steht ist die berechtigte Frage nach dem Sinn dieser ganzen Überlegung. Stellen wir nur einfach mal die abschliessende Aussage "Die Wesentlichkeit unserer Welt ist Realität." in den Raum, dann ist das für sich genommen, eine fast so banale Aussage wie "Ich denke, also bin ich." So wirkt es zumindest. Aber alle Menschen, die den Kontext zu Descartes "Ich denke, also bin ich." kennen, würden diesen Satz, der die Individualisierung in unserer Gesellschaft erst ermöglicht hat, sicher nicht als banal bezeichnen. So wie das Denken das Sein bestimmt, so bestimmt heute das Erkennen von Realität die Welt. Das Wissen um die Substanz dieser Aussage reicht aber nicht - diese Aussage muss mit Leben gefüllt werden.
Dafür hat der liebe Gott den Dorfpoeten erfunden.- Wenn sie also in meinen Texten das Wort "Wesentlichkeiten" lesen oder hören - jetzt wissen Sie Bescheid ;-)
8. Januar 2014
Hey, Patricia
Keine Ahnung, ob sie wirklich so hiess. Ich nenne sie einfach mal so. Gracia als Name wäre zu grazil. Patricia ist auch überhöht, distanziert, aber irgendwie passend. Vermutlich hieß sie ganz anders. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gefragt.
5. Januar 2014
"Arbeit und Struktur" - Das Vermächtnis des Wolfgang Herrndorf
Die Kultur-Magazine besprechen "Arbeit und Struktur" durchweg positiv. Geschieht dies nur aus Respekt vor dem Autor? Herrndorf selbst bezeichnet sich selbst als "Behelfsschriftsteller". Besseres Mittelmaß vielleicht. Untergegangener Bachmannpreis-Teilnehmer. Einer aus dem "Riesenmaschine"-Dunstkreis um Kathrin Passig und Sascha Lobo, beide zu Lebzeiten kommerziell erfolgreicher, bekannter. Jetzt erscheint also das Sterbe-Tagebuch von Herrndorf. Darf man das kritisieren? Wäre dieses Buch ohne das tragische Ende überhaupt in den Bestsellerlisten?
Herrndorf hat sich das selbst auch gefragt. Er schreibt schon 2010, als die beinahe panische Arbeit an seinem Roman "Tschick" - er weiß ja nicht, wie viel Zeit ihm zur Vollendung seiner Arbeit noch bleibt - ihrem Ende entgegenstrebt: "Abends kommen mir so starke Zweifel an dem Buch, dass ich mich frage, ob das Geld von Rowohlt auf regulärem Wege zustande gekommen ist oder Helfer ihre Finger im Spiel gehabt haben. Ich frage mich das ernsthaft."
Es ist makaber, aber natürlich ist ein sterbender Autor mit unzweifelhaftem literarischen Talent für einen Verlag lukrativ. Aber wie sieht das der Autor selbst? Schon im August 2010 schreibt er: "Mir ist nicht klar, wie man aus dieser ´Nachruhm-Sache´ irgendeinen Trost ziehen kann."
Als "Tschick" dann zum Bestseller avanciert, kann er von seiner Bruchbude, in eine richtige Wohnung umziehen. Aber die Lebenszeit, diese Genugtuung zu geniessen, ist sehr knapp bemessen und durch Anfälle und Kämpfe gegen den Verlust des Verstandes, in der Lebensqualität sehr eingeschränkt. Herrndorf, als Autor, hat nichts von seinem Nachruhm. "Die Zukunft ist abgeschafft. Ich plane nichts, ich hoffe auf nichts, ich freue mich auf nichts, außer auf den heutigen Tag." - oder -"Jetzt könnte ich sechsstellige Summen verdienen. Und es gibt nichts, was mir egaler wäre."
Schon im März 2010 schreibt Herrndorf: "Ich (...) weiß: Ich brauche eine Waffe.". Er nennt es "Exitstrategie" - der Versuch, der in die Gewissheit münden soll, selbst das Ende zu bestimmen. Ein anderes Wort, das immer wieder auftaucht ist "Psychohygiene". Er scheint von Anfang an die verschiedenen Möglichkeiten abzuwägen. Was, wenn der Schuss nicht das Ende bedeutet?: "X., die Erschießen für zu unsicher hält, kündigt an, dass sie in diesem Fall vor der Tür warten wird. Warten, bis sie den Schuss gehört hat und dann reinkommen und den Rest mit der Plastiktüte erledigen, falls nötig."
Im April 2010 scheint schon der Tiefpunkt erreicht zu sein - aber er wird noch mehr als drei Jahre durchhalten: "Ich kann nicht mehr googeln, es zieht mich runter. Organspendeausweis im Portemonnaie gefunden und weggeworfen. Der genetische Schrott, der meinen Geist beherbergt, ist jetzt wertlos." Überhaupt ist das Googeln zu neuen Studien, neuen Hoffnungsschimmern zu seiner Krankheit, eine manische Beschäftigung: "Selbstdiagnose ohne Wikipedia unmöglich."
"Arbeit und Struktur" ist ein Manifest, ein systematisches Bekenntnis zur sinnvollen Nutzung der eigenen Lebenszeit. Herrndorf möchte die wenige Zeit, die ihm bei klarem Verstand vergönnt ist, sinnvoll für seine Arbeit nutzen. Dafür muss er jeden Tag um die passenden Strukturen kämpfen. So stößt er Menschen vor den Kopf, die ihm diese Zeit mit Mitleidsbekundungen rauben. Er liest nur noch, was lesenswert ist. Er spielt Fussball, er geht Schwimmen. "Große Lektüre von großem Mist zu scheiden, ist ein zeitraubendes Unterfangen."
So wird er auch zu einem präzisen Chronisten, reduziert Nachrichten aus das Wesentliche. Er nimmt Teil am Weltgeschehen und kommentiert das Israel-Gedicht von Grass, den Horror von Fukushima oder das tägliche Einerlei im Fernsehen: "Im Frühjahr noch verursachte Heidi Klum im Fernsehen mir Todesangst. Nicht polemisch jetzt oder als lustige feuilletonistische Übertreibung, sondern tatsächlich: Todesangst. Nackte Angst. Das nutzlose Verrinnen der Zeit."
Herrndorf ist Hin- und hergerissen zwischen Verzweiflung, Stärke, Arbeitsdrang und dem Kampf mit der Nostalgie. Bittere Ironie, die nicht nur unfreiwillig komisch wirkt. Herrndorf ist froh, als er seine vermutlich letzte Steuererklärung machen muss. Aber im ersten Jahr sterben sei für Muschis. Und als die erste von drei Hirnoperationen ansteht, quittiert er es mit drei Worten: "Auf Wiedersehen. Haare."
Seine Verzweiflung drückt Herrndorf präzise ohne Umschweife aus. Er schreibt, wenn er weinen musste. Er schreibt, wenn ihm alles zu viel ist: "Das Eingeständnis der kompletten Sinnlosigkeit des eigenen Lebens. Nichts neues, aber so grauenvoll war es selten. (...) Nie wieder wird sich jemand in mich verlieben. Stinkend und krebszerfressen."
Es wird über die Monate hinweg immer schlimmer. "Meine Freunde reden mit einem Zombie. Das macht mich traurig." Sein Internettagebuch füllt er in klaren, wachen Momenten. Dann, wenn er keine Anfälle hat. Diese Anfälle äußern sich durch komplette Desorientierung. Er fragt Passanten nach dem Weg, obwohl er schon angekommen ist. Blut läuft aus seinem Mund, weil er sich unkontrolliert auf die Zunge beisst. Und als er Gefahr läuft, gewalttätig zu werden, weist er sich selbst in die Psychiatrie ein. Groß. Ganz groß.
Herrndorf hat große Angst davor, dass die Berichterstattung über ihn, in die falsche Richtung läuft. Als die Tagesthemen mit ihm ein Interview machen wollen, möchte er eine Garantie dafür haben, dass auf keinen Fall "armer Hirnkranker, schreibt sein letztes ergreifendes Buch" als Eindruck zurückbleibt. Diese Garantie bekommt er nicht.
Die Garantie ist die Lektüre von "Arbeit und Struktur" selbst. Das ist keine voyeuristische Mitleidslektüre. Herrndorf sagt selbst, dass die letzten drei Jahre seines Lebens die besten waren. Das spürt man in und zwischen den Sätzen. Bei allem Leid, bei allem mitleiden, wenn die Monate des Tagebuchs von neuen Diagnosen, neuen Operationen, neuen, stärkeren Anfällen geprägt sind - Herrndorf transportiert darüber hinaus die Essenz des Lebens, das sich Konzentrieren auf, das Geniessen von Wesentlichkeiten. Freundschaften, die Kostbarkeit von Zeit, die Nichtigkeit von Geld und Prestige. Herrndorf bringt es pointiert auf den Punkt: "Ein großer Spaß, dieses Sterben. Nur das Warten nervt."
"Arbeit und Struktur" ist ein beeindruckendes Zeitdokument. Es transportiert das Wesen von dem, was das Leben ausmacht, im Spiegel der Zeit. Im Spiegel steht der Autor selbst, der Mühe hat sich zu erkennen. So lange es gelingt, so lange lebt der Autor. Gelingt es nicht mehr, dann greift die Exitstrategie.
Kritik bei zeit.de
Kritik bei der Süddeutschen.
Arbeit und Struktur
Eines davon habe ich erst gestern auf der Fähre und im Zug auf der Rückfahrt gelesen. Da ich davon ausgehen musste, dass das Thema sehr ernst ist und das Buch das Potenzial gehabt hätte, mir durch zu viel Nachdenklichkeit den Urlaub zu Beginn zu versauen, war Wolfgang Herrndorf und sein Vermächtnis "Arbeit und Struktur" genau passend für das Ende des Urlaubs. Die Lektüre hat auch genau in die knapp neun Stunden Rückfahrt gepasst.
Es ist ein sehr beeindruckendes Buch. Die Rezension dazu aktuell in meinem Kultur-Magazin.
2. Januar 2014
Auf meiner Insel 13
Ich war in 2013 dreimal auf Amrum. Im März, im November und dann noch mal im Dezember/Januar. Insgesamt war ich jetzt das sechste Mal auf Amrum in den letzten 2,5 Jahren. Amrum ist also mein bevorzugtes Urlaubsziel, keine Frage. Jedes Mal entdeckt man etwas neues. Und dann diese herrliche Ruhe, selbst zum Jahreswechsel. Man kann sich mit Dingen beschäftigen, für die man sonst im Jahr keine Ruhe findet. Die Ergebnisse von dieser Ruhe zeigen sich über die kommenden Monate hinaus - wieder habe ich neue Ideen, neue Inspiration gefunden.
Der nächste Urlaub hier ist quasi schon so gut wie gebucht ;-)
Ein paar neue Fotos gibt es auch heute wieder: amrum.killert.de
Labyrinth ohne Wände
im Labyrinth ohne Wände
Die Tage sind kein Stolpern mehr
Über Steine im Weg
Der Tag
ist das Zurechtfinden
fest gefasst
orientiert
Im Geworfensein unter den Himmel
Licht und Wolken und Wind
und die vielen Menschen
um mich herum
Suchend ebenfalls
Im Labyrinth ohne Wände
und sie sind dort bestenfalls
Treibholz für andere.
1. Januar 2014
Auf meiner Insel 12
Um 0:00 Uhr hupte die Sirene der im Hafen von Wittdün liegenden "MS Schleswig Holstein" drei Mal. Das war auch schon alles an Action in der Silvester-Nacht. Auf der gesamten Insel ist laut Verordnung das Feuerwerk verboten. Nur ganz in der Ferne, am Strand der Nachbarinsel Föhr, waren einige Raketen zu sehen.
Die Polizei hat dieses Verbot auch durchgesetzt. Immer wieder fuhr ein Streifenwagen durch das Hafengebiet, denn einige wenige Idioten hatten wohl Böller mitgebracht. Diese Knaller waren aber wirklich nur ganz vereinzelt irgendwo zu hören.
Das war also ein wohltuendes, ruhiges Silvester. Gegen Mittag hat die erste Fähre die Insel wieder verlassen. Waren bis gestern die ankommenden Fähren überfüllt, so ist jetzt das Gegenteil der Fall. Die Menschen verlassen die Insel wieder. Zumindest die, die wirklich nur zum Jahreswechsel hier waren. Ich habe noch zwei Tage. Die werde ich natürlich noch geniessen.
Euch allen ein schönes, gesundes und erfolgreiches 2014!
Fotos: amrum.killert.de